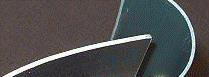Hallo Bernd,
vielen Dank, dass Du Dich trotz der Länge durch meine Beschreibungen "gekämpft" hast. Es ist nicht leicht, die Theorie in praxisnahe Beispiele zu betten.
Ich vermute die Missverständnisse rühren daher, dass die zwei Formeln zwei völlig unterschiedliche Effekte beschreiben, die aber im Falle einer Spule letztendlich auf das gleiche Ergebnis herauslaufen. Dabei ist es wichtig, die zeitliche Komponente der Vorgänge zu berücksichtigen.
Also Formel 2 beschreibt den Vorgang, dass sich die Anzahl der Magnetfeldlinien die durch die innere Fläche einer Spule treffen ändert. Wenn ich eine Spule nehme und einen Magneten quer dazu darüber "fahre", dann treffen irgend wann alle Magnetfeldlinien durch die Spuleninnenfläche und wenn der Magnet wieder neben der Spule ist keine Magnetfeldlinie mehr (wenn ich die außen am Magneten zurückfließenden Magnetfeldlinien wegen geringerer Dichte sehr großzügig vernachlässige). Wenn Du Dir dieses Szenario vorstellst, dann schaltet der Magnet das Magnetfeld, das in der Spule wirksam wird, genau ein Mal "ein" und "aus". Sorry, wenn ich so einfache und vielleicht ungewohnte Begriffe verwende. In diesem Versuch polt noch nix um.
Deine Beobachtungen, die Du bei den Messungen machst, entsprechen der Formel 1. Diese darfst Du bei Formel 2 versuchen zu "vergessen". Ich weiß, das widerstrebt, aber sonst kommst Du aus den Missverständnissen nicht heraus. Formel 2 ist mehr theoretisch zu verstehen, denn unsere Anwendung, lassen den anderen Effekt deutlicher werden.
Formel 1 beschreibt ja das Überstreichen des Magneten eines Leiters. Deswegen ist beim Eintritt in die Spule eine hohe induzierte Spannung und beim Austritt in die Gegenrichtung messbar.
Formel 2 beschreibt es so, dass Spannung induziert wird, wenn die Magnetfeldlinien zunehmen und in die andere Richtung induziert wird, wenn die Anzahl der Magnetfeldlinien wieder abnimmt.
___
Punkt 3: Ja! Formel 1 berechnet den Peak-Wert. Wenn ich ein konstantes Magnetfeld hätte bleibt auch die induzierte Spannung immer Upeak. Darauf bezog sich meine Formulierung "eigentlich" homogen. Klar kann/darf man auch diese Formel auch verwenden, wenn man einfach alle Zeitabschnitte ermittelt und anschließend den Mittelwert bildet.
Ich sehe keine Wiedersprüche in unseres Aussagen, höchstens unterschiedliche Beschreibungen des gleichen Sachverhalts. Was wem zur Veranschaulichung dienlicher ist, ist ja auch nicht entscheidend.
Lieben Gruß
Richard, der keineswegs als Besserwisser auftreten will, sondern ausschließlich um tieferes Verständnis bemüht ist, um anschließend ein Optimum zu finden. Und das am liebsten gemeinsam, denn nur dann wird es DAS Optimum.
Grundlagen der Induktion
Re: Grundlagen der Induktion
Deine Beobachtungen, die Du bei den Messungen machst, entsprechen der Formel 1. Diese darfst Du bei Formel 2 versuchen zu "vergessen".
Ich weiß, das widerstrebt, aber sonst kommst Du aus den Missverständnissen nicht heraus. Formel 2 ist mehr theoretisch zu verstehen, denn unsere
Anwendung, lassen den anderen Effekt deutlicher werden.
Welche Beobachtungen? Was kann man vergessen ???
Sorry aber ich habe keine Vorstellung was du rüber zu bringen versuchst.
Formel 1 beschreibt ja das Überstreichen des Magneten eines Leiters.
Deswegen ist beim Eintritt in die Spule eine hohe induzierte Spannung und beim Austritt in die Gegenrichtung messbar.
Es ist dafür gar keine Spule nötig. Hierbei zählt nur das Einwirken auf einen Leiter.
Die Induktionformel nach Faraday 2 (die mit der Induktion direkt in den Leiter hinein) beschreibt den Aufbau einer Potentialdifferenz
durch das Separieren von Ladungsträgern durch das direkte Einwirken eines bewegten Magnetfeldes auf einen Leiter.
Wie stark der Effekt ausfällt ist von der relativen Geschwindigkeit zwischen Leiter und magnetischen Fluss sowie dessen Höhe abhängig,
nebst der wirksamen Länge des Drahtes.
Vielleicht hilft Dir das weiter :
Wir hatten im Amiforum schon mehrmals Generatoren bzw. Induktionen mit beiden Formeln durchgerechnet und kamen immer auf
sehr ähnliche Ergebnisse. Es bleibt jedem selbst überlassen welchen Rechenweg er geht, er muss nur wissen was er macht denn es gibt
viele Stolpersteine von denen wir einen Teil durch die Vereinfachung der "Formel 1 " versucht haben zu umgehen. So rechnet die hier
nachzulesende Formel z.B. mittlerweile gleich den Effektivwert der erzeugten Spannung aus, einen sauberen Sinus unterstellend.
Grüsse
Bernd
Formel
- Bernd
- Beiträge: 8417
- Registriert: So 4. Jan 2009, 10:26
- Wohnort: nähe Braunschweig
Re: Grundlagen der Induktion
Hallo Bernd,
danke, dass Du darauf achtest, dass wir uns auf gemeinsame Begriffe und Bezeichnungen festlegen. Das erleichtert in Zukunft die Verständigung.
o.k. damit der Winkel phi (wie Winkel, üblicher Weise in griechichen Buchstaben gekennzeichnet werden) in diesem Fall nicht mit der magnetischen Flussdichte groß PHI verwechselt werden kann, ersetze ihn einfach mit alpha oder beta.
Unter der Formel hatte ich allerdings diesen Winkel phi noch genauer erklärt. Außerdem macht der cosinus der magnetischen Flussdichte nicht umbedingt viel Sinn .
.
B ist ein Maß für die Wirkung des magnetischen Feldes. Errechnet sich unter anderem aus B = mü(r) * mü(null) * H
H: der magnetische Feldstärke
Nein ich wollte schon die Formel für den magnetischen Fluss wiedergeben:
PHI = B * A * cos (alpha)
Ich hoffe, das passt jetzt so.
Herzlichen Gruß und danke für´s Korrekturlesen.
Richard
danke, dass Du darauf achtest, dass wir uns auf gemeinsame Begriffe und Bezeichnungen festlegen. Das erleichtert in Zukunft die Verständigung.
o.k. damit der Winkel phi (wie Winkel, üblicher Weise in griechichen Buchstaben gekennzeichnet werden) in diesem Fall nicht mit der magnetischen Flussdichte groß PHI verwechselt werden kann, ersetze ihn einfach mit alpha oder beta.
Unter der Formel hatte ich allerdings diesen Winkel phi noch genauer erklärt. Außerdem macht der cosinus der magnetischen Flussdichte nicht umbedingt viel Sinn
B ist ein Maß für die Wirkung des magnetischen Feldes. Errechnet sich unter anderem aus B = mü(r) * mü(null) * H
H: der magnetische Feldstärke
Nein ich wollte schon die Formel für den magnetischen Fluss wiedergeben:
PHI = B * A * cos (alpha)
Ich hoffe, das passt jetzt so.
Herzlichen Gruß und danke für´s Korrekturlesen.
Richard
- MaRiJonas
- Beiträge: 215
- Registriert: Fr 20. Jan 2012, 17:49
Re: Grundlagen der Induktion
Unter dem Buchstaben " B " kenne ich gemeinhin in Bezug auf magnetische Grössen die magnetische Flussdichte in Tesla.
Was sagt "dein B " denn genau aus ?
Mein " B " ist die magnetische Flussdichte.
Willst du von einer (bereits bekannten) magnetischen Flussdichte auf den magnetischen Fluss zurück rechnen ?
Wenn ja warum bzw. zu welchen Zweck ?
Welche Aussage wolltest du eigentlich mit der Nennung der Formel für den magnetischen Fluss treffen ?
Für uns ist doch nicht der Fluss sondern die Flussdichte für unsere Berechnungen entscheidend.
Ich verliere den Faden welchen Sinn das ganze macht.
Grüsse
Bernd
Was sagt "dein B " denn genau aus ?
Mein " B " ist die magnetische Flussdichte.
Willst du von einer (bereits bekannten) magnetischen Flussdichte auf den magnetischen Fluss zurück rechnen ?
Wenn ja warum bzw. zu welchen Zweck ?
Welche Aussage wolltest du eigentlich mit der Nennung der Formel für den magnetischen Fluss treffen ?
Für uns ist doch nicht der Fluss sondern die Flussdichte für unsere Berechnungen entscheidend.
Ich verliere den Faden welchen Sinn das ganze macht.
Grüsse
Bernd
- Bernd
- Beiträge: 8417
- Registriert: So 4. Jan 2009, 10:26
- Wohnort: nähe Braunschweig
Re: Grundlagen der Induktion
MaRiJonas hat geschrieben:B ist ein Maß für die Wirkung des magnetischen Feldes. Errechnet sich unter anderem aus B = mü(r) * mü(null) * H
H: der magnetische Feldstärke
Hallo Richard,
Unter B versteht man immer Flußdichte die vom einem Magneten ausgeht,die kann man mittels Krupp-Program ermiteln.So brauchen wir nicht über Feldstärke das gleiche rechnen.Und bei diese Formeln kommt man auch an Fantasiewerte für B wenn man Micro r falsch eingibt.Nämlich das Micro r aus Tabellen(habe welche) kann man vergessen,er ist zu hoch,z.B. für Eisen steht da um 6000, es ist 20 mal kleiner!
Diese Formeln ist richtig("unsere") haben auch mit Versuchen das bekräftigt.Und Flußdichte rechnet man wen man mit E-Magneten genis macht.Dan aber über Weber,und danach über Feldstärke.Wir haben aber fertige Magnete so brauchen wir nur Wert die bei Spulen ankomt.Das geht über diese Programm.(Krupp).
Grüße
Ekofun
- Ekofun
- Beiträge: 3892
- Registriert: Mi 23. Feb 2011, 15:44
- Wohnort: Kroatien-Nova Gradiska
Re: Grundlagen der Induktion
Bernd hat geschrieben:Ich wollte die Induktion in der Spule eines eisenlosen Generators mit der Formel für die "Spuleninduktion" berechnen bei der die
Berechnung über den Flächeninhalt des Spulenkerns geschieht.
Was mir noch im Hinterkopf hängen geblieben war ist das diese Formel den Effektivwert der induzierten Spannung ausspuckt.
Ich hatte mir mal als Formel notiert :
Ui = 2 * B * A * N / t
B = magnetische Flussdichte in Tesla
A = Fläche des Magneten oder des Spulenkerns, je nachdem was kleiner ist. Der kleinere Wert gilt
N = Windungsanzahl
t = Zeitdauer in der eine halbe Sinusschwingung, also eine einzelne Amplitude erzeugt wird
Es ist die Zeitdauer die ein Magnet von einer zur nächsten Spule benötigt in Sekunden
Mir fällt auf das ich das Endergebnis mal 2 nehmen muss um auf das gleiche Ergebnis für den Effektivwert der induzierten
Spannung zu kommen wie das Ergebnis das mit folgender Formel errechnete:
Ui = B * L * N * 2 * V
U induziert (in Volt)
B = magnetische Flussdichte (in Tesla)
L = Spulenschenkellänge (in Meter)
N = Windungsanzahl
V = Magnetumfangsgeschwindigkeit (in m/s)
Mir ist derzeit schleierhaft wieso ich das Ergebnis der obigen Formel noch mal 2 nehmen muss um auf der Ergebnis
der unteren Formel zu kommen. Vielleicht muss man den Wert für den magnetischen Fluss verdoppeln, da sich ja das
Feld während einer Induktion umkehrt. Dieses Vorgehen würde das "Problem" lösen.
Grüsse
Bernd
Auf diese Fragestellung wollte ich bislang eine Erklärung abgeben. Dann versuche ich Mal Deine verwendete Formel in die von mir ins Spiel gebrachte zu überführen.
"Deine" Formel für die Spuleninduktion lautet:
Ui = 2 * B * A * N / t
"Meine" Formel für die Spuleninduktion lautet:
Ui = delta PHI/delta t, mit
PHI = B * A, mit
B für magnetische Flussdichte, zum Glück meinten wir das gleiche B
A für die Summe aller Fläche der einzelnen Wicklungen, also N * "Deinem" A
ergibt also
Ui = delta (B * "Deinem" A * N )/delta t
Mein t ist die Zeitdauer in der sich das B-Feld von 0 (vor Eintritt in die Spule) auf ein Maximum erhöht (Magnet direkt über der Spule, besser gesagt im Zentrum der Spule) --- hier ist entscheidend, dass es sich nur um das Maximum der magnetischen Flussdichte handelt, welches nichts mit dem Maximum der induzierten Spannung zu tun hat. Solange sich ein kleiner Magnet innerhalb des Spulenzentrums bewegt, entsteht keine Änderung der magnetischen Flussdichte und somit wird auch keine Spannung induziert.
So, jetzt kommt mein irrtümlich, als von mir neu entdeckter Faktor 2 ins Spiel, den Du ja bereits in der Formel hast, denn Deine Zeit ist doppelt so lang wie meine. Also tritt mein Magnet auch wieder aus der Spule heraus und die magnetische Flussdichte sinkt wieder auf 0.
Das ergibt dann also:
Ui = 2 * B * A * N /t
was exakt Deiner Formel entspricht. Jetzt ist allerdings immer noch fraglich, warum Du diesen Wert mit 2 multiplizieren musst, damit sich mit den Messungen und der anderen Formel deckt.
Eine neue Vermutung von mir wäre jetzt, dass in der Zeitspanne wo der Magnet zur nächsten wadert bereits ein neuer Magnet in das Zentrum der Spule eintritt und dass beim Eintritt des Magneten in das Zentrum der Spule, der sich darin bereits befindende heraus bewegt wird.
Dann hättest Du durchaus recht, dass es sich wegen der Feldumkehr um den Faktor 2 handelt.
War das jetzt verständlich?
Richard
- MaRiJonas
- Beiträge: 215
- Registriert: Fr 20. Jan 2012, 17:49
Re: Grundlagen der Induktion
Ekofun hat geschrieben:Hallo Bernd,
habe noch etwas über Induktion, so genante Induktiongesez.
Erste Behauptung: Induzierte Spanung ist proportional der Windungszahl.
Zweite Behauptung: Die in eine Spule induzierte Spanung ist umso höher,je größer der Windungszahl,je größer die Flußänderung und je kürzer Zeit ist,in der diese Flußänderung erfolgt.
Änderung des magnetischen Flusses bezeichnet man mit ∆Φ,die Zeit indem das geschiet mit ∆t.
Formel: Ui = -N*∆Φ/∆tUi --Induzierte Spanung
N --Windungszahl
∆Φ-Änderung des magn.Flusses
∆t--Zeit in den diese Änderung geschiet
--------------------------------------------------
Beispiel: Aus eine Spule mit 600 Wdg. wird ein Magnet mit mag.Fluß vom 2,5 mWb inerhalb 3 Sekunden herausgezogen.
Wie groß ist induzierte Spanung bei gleichmäßiger Flußänderung??
Ui = -N * ∆Φ /∆t = -600* -2,5mVs/3 = 600*0,0025/3 = 0.5V
Das negative Vorzeichen ist durh die Lenzsche Regel bedingt.
Denke das gilt auch wenn ein Magnet über Spule fährt,wie auch immer ,wenn nicht kann man es vergessen.
Grüße
Ekofun
Hallo Ekofun,
genau das ist also die Formel, die ich verwendet habe und in die von Bernd notierte Induktionsformel für Spulen übergeführt habe.
Sind wir jetzt gleicher Meinung und verstehen wir jetzt einander?
Gruß
Richard
- MaRiJonas
- Beiträge: 215
- Registriert: Fr 20. Jan 2012, 17:49
Re: Grundlagen der Induktion
B für magnetische Flussdichte, zum Glück meinten wir das gleiche B
jaja...räusper hust hust.....
A für die Summe aller Fläche der einzelnen Wicklungen, also N * "Deinem" A
A entspricht in dieser Formel der Fläche des Spulenkerns oder des Magneten, je nachdem was kleiner ist, nicht einer Wicklung.
So, jetzt kommt mein irrtümlich, als von mir neu entdeckter Faktor 2 ins Spiel, den Du ja bereits in der Formel hast, denn Deine Zeit ist doppelt so lang wie meine.
Kleine Enttäuschung, die Berechnung dieser Formel bezieht sich, was " t " betrifft, nur auf die Zeitdauer der Induktion einer Halbwelle.
Grüsse
Bernd
- Bernd
- Beiträge: 8417
- Registriert: So 4. Jan 2009, 10:26
- Wohnort: nähe Braunschweig
Re: Grundlagen der Induktion
Bernd hat geschrieben:A entspricht in dieser Formel der Fläche des Spulenkerns oder des Magneten, je nachdem was kleiner ist, nicht einer Wicklung.
Doch, doch Bernd. Das ist schon das selbe, was wir meinen. Dein Magnet "sendet" am Nordpol eine bestimmte Anzahl an Magnetfeldlinien aus, sagen wir Mal 100 Magnetfeldlinien. Der Magnet sei 10 * 10 mm groß. Macht eine Magnetfeldlinie je Quadratmillimeter. Dein Spulenkern sei 20 * 20 mm groß. Es gilt bei Deiner Formel nun die kleinere Fläche von 100 Quadratmillimeter.
Bei "Ekofuns" Formel gilt die Anzahl der Magnetfeldlinien, die eine Wicklung betreten oder verlassen als Mass der Dinge.
Der Magnetische Fluss ist hier auf die Fläche des Spulenkerns (von mir als Fläche einer Wicklung benannt) einfach gleichmäßig aufgeteilt, weil es egal ist WO sich die Magnetfeldlinie im Zentrum der Spule befindet. Es wird nur der Übergang "registriert".
Mein B wäre dann um ein Viertel kleiner als Deines, weil es bei mir nur 25 Magnetfeldlinien je 100 qmm Fläche des Spulenkerns wären. Das mal 4 ergibt wieder unsere 100 Magnetfeldlinien die durch die Spule treffen.
Bernd hat geschrieben:Kleine Enttäuschung, die Berechnung dieser Formel bezieht sich, was " t " betrifft, nur auf die Zeitdauer der Induktion einer Halbwelle.
KEINE Enttäuschung
Wenn Du jedoch zwei wechselseitige Magneten im Abstand einer Halbwelle angeordnet hast, dann verdoppelst Du die induzierte Spannung, die meine Formel berechnet. Denn wenn ein Südpol die gleiche Spule im selben Zeitpunkt betritt, wie ein Nordpol diese Spule verlässt, dann verdoppelt sich die induzierte Spannung.
Darin vermute ich den von Dir gesuchten Faktor 2.
Gruß
Richard
- MaRiJonas
- Beiträge: 215
- Registriert: Fr 20. Jan 2012, 17:49
Re: Grundlagen der Induktion
KEINE Enttäuschung, denn mein t bezieht sich nur auf eine Viertelwelle, nämlich Nordpol betritt die Spule, die zweite Viertelwelle ist, wenn Nordpol die Spule verlässt.
Auf eine halbe Halbwelle also viertel einer vollen Sinusschwingung ?
Gut man kann Parameter ja variabel verändern bis die Formel zum Realität passt.
Bislang war mir allerdings noch keine Formel untergekommen bei der ich als " t " die Zeitdauer für eine halbe Halbwelle bzw, viertel Sinusschwingung einsetzen sollte.
Der Magnetische Fluss ist hier auf die Fläche des Spulenkerns (von mir als Fläche einer Wicklung benannt) einfach gleichmäßig aufgeteilt,
Also ich finde du solltest dich schon korrekt ausdrücken und wenn nachgehakt wird nicht plötzlich die Umschreibung "Fläche der einzelnen Wicklungen", also die
Fläche der Spulenschenkel, nachträglich zur Fläche des Spulenkerns umtaufen.
eine andere Bedeutung erhalten. Sicher hätte ich das auch durch deinen nachfolgenden Satz zusammen deuten können, aber bei so komplexen Dingen sollten
Bezeichnungen eindeutig ausfallen.
Das nur die Änderung des magnetischen Flusses innerhalb des Spulenkerns entscheidend ist ist klar, deshalb hatte ich ja auch geschrieben
das für die Flächenberechnung innerhalb der Formel die Fläche des Spulenkerns ODER die des Magneten herangezogen wird, je nachdem welche KLEINER ausfällt.
Das hast du anscheinend überlesen. Das steht übrigens auch genau so schon lange im Forum.
Bei "Ekofuns" Formel gilt die Anzahl der Magnetfeldlinien, die eine Wicklung betreten oder verlassen als Mass der Dinge.
Mit "Wicklung betreten" was ist damit genau gemeint, die Spulenschenkel, der Spulenkern ? Siehe oben.....
Meine Formel, Ekofuns Formel, bitte nenne genau das was du meinst.
Ich glaube es gibt nicht deine oder meine Formel, das sind physikalische Berechnungen und Gesetzmässigkeiten die es schon lange vor uns gab.
Du nennst oft Dinge die längst bekannt sind und stellst sie teils als neue Erkenntnisse durch dich dar.
Es ist löblich das du längst bekannte Dinge für themenfremde ein weiteres mal neu erklärst anstatt zu versuchen nur die noch offene Fragen zu beantworten,
aber es wirkt teils komisch denn so ganz ohne Wissen waren wir davor ja nun auch nicht um es mal vorsichtig zu formulieren. So grundsätzliche Dinge wie z.B. das
Eisen den magnetischen Fluss kanalisiert oder andere grundsätzliche Abläufe als auch weit komplexere Dinge sind sicher nicht nur mir schon vorher nicht gerade
fremd gewesen. Vielleicht kannst du das nachvollziehen.
Es ist ein grosses Forum und es steht doch schon allerhand drinnen.
Wenn Du jedoch zwei wechselseitige Magneten im Abstand einer Halbwelle angeordnet hast, dann verdoppelst Du die induzierte Spannung, die meine Formel berechnet.
Denn wenn ein Südpol die gleiche Spule im selben Zeitpunkt betritt, wie ein Nordpol diese Spule verlässt, dann verdoppelt sich die induzierte Spannung.
Du beziehst dich auf das was ich dir zuvor erklärte, wo du zunächst annahmst das es keine Änderung des magnetischen Flusses nach sich zieht wenn zwei gegensätzlich
gepolte Magnete dicht aneinaner liegend über einen Spulenkern hinweg fahren ?
Das wäre experimentel zu beweisen, denn wenn ich auch ähnliches vermute, so würde es doch bedeuten das eine Magnetanordnung in einem Scheibengenerator mit
grossen Abstand zwischen den Magneten nur die Hälfte der Peakinduktion einer einzelnen (!) Halbwelle hervorbringen würde wie eine dichte Magnetbestückung.
Genau über diesen Punkt habe ich schon mal vor längeren gegrübelt.
Mein gesunder Menschenverstand sagt mir aber das das nicht in dieser Form möglich ist, denn dann würde eine enge Magnetbestückung mit sagen wir doppelt so vielen
Magneten, nicht nur per se schon doppelt so viele Induktionen nach sich ziehen, nein die einzelnen Induktionen wären auch noch doppelt so hoch.
Das würde bedeuten "nur" doppelter Materialeinsatz aber vierfache Spannung bzw. 16fache Leistung. Klingt unwahrscheinlich, aber reizvoll.
Das sollte man mal testen.
Im Umkehrschluss wäre eine aus Kostengründen durchgeführte weitläufige Magnetbestückung mit grossen Asbtänden zwischen den Magneten, so wie man es manchmal
bei Hobbybastlern antrifft, energetisch eine Katstrophe.
Grüsse
Bernd
- Bernd
- Beiträge: 8417
- Registriert: So 4. Jan 2009, 10:26
- Wohnort: nähe Braunschweig
Zurück zu Grundlagen Generatorbau
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste